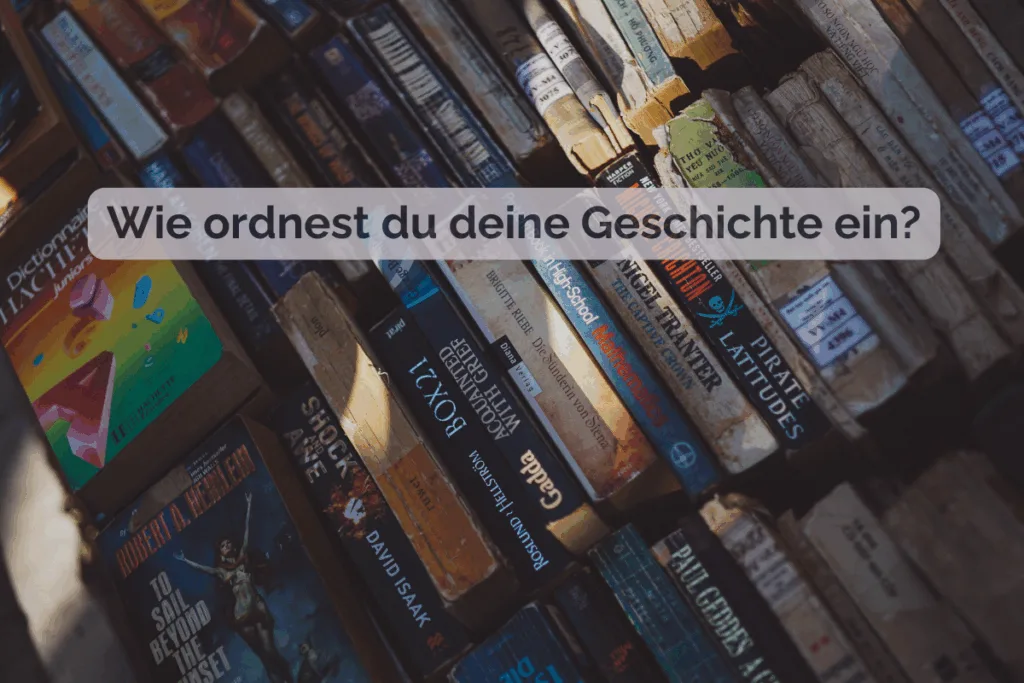
Wenn ich mit ein Science-Fiction-Manuskript lektoriere, achte ich selten zuerst auf die Technik. Ich konzentriere mich darauf, wie sich die Welt darin anfühlt. Manche Geschichten wirken wie ein enges Korsett, als würden sie ihre Figuren festhalten. Andere eröffnen schon im ersten Absatz ein ganzes Universum.
Genau dort taucht bei vielen Autorinnen dieselbe Frage auf. Welche Art von Zukunft erzähle ich eigentlich? Wo ordne ich mein Projekt ein? Was bestimmt den Ton meiner Welt?
Subgenres sind kein Regelwerk. Sie bieten eine Orientierung. Wenn du ihre Richtung kennst, lässt sich dein Projekt leichter einordnen.
Lass uns die wichtigsten Bereiche gemeinsam anschauen. Nicht, um dich festzulegen, sondern um besser zu verstehen, wohin deine Geschichte tendiert.
Dystopie
Dystopien erzählen von Gesellschaften, in denen Strukturen brüchig geworden sind. Es geht nicht nur darum, dass etwas schief läuft, sondern darum, wie sich diese Schieflage im Alltag bemerkbar macht. Viele Geschichten wirken deshalb von Anfang an angespannt. Die Figuren stehen unter Beobachtung, müssen sich anpassen oder ständig darauf achten, keine Grenze zu überschreiten.
Im Lektorat sehe ich bei dystopischen Texten oft, wie stark die äußeren Bedingungen das Schreiben prägen. Plötzlich ergibt jede Entscheidung einer Figur nur Sinn, wenn man das System dahinter versteht. Eine kleine Handlung kann große Folgen haben. Ein kurzer Dialog kann zeigen, wie eng die Welt geworden ist. Die Gesellschaft ist nicht nur Hintergrund, sondern Teil des Konflikts.
Gute Dystopien verlieren sich jedoch nicht im Weltenbau. Sie fragen, was diese Umgebung mit den einzelnen Menschen macht. Wo sie sich fügen. Wo sie ausbrechen. Wo sie resignieren. Und wo sie anfangen, nach einem Ausweg zu suchen.
Woran du erkennst, dass du im dystopischen Bereich schreibst:
Die zentralen Konflikte entstehen durch äußere Zwänge. Regeln, Überwachung oder soziale Hierarchien wirken direkt auf deine Figuren ein. Nicht der persönliche Streit steht im Vordergrund, sondern die Art, wie Menschen in einer fehlerhaften oder unterdrückenden Ordnung handeln müssen.
Utopie
Utopien werden häufig mit perfekten Welten verwechselt. In vielen Manuskripten zeigt sich jedoch, dass es eher um Alternativen geht als um Idealzustände. Autor*innen entwerfen keine fehlerlose Zukunft, sondern eine, in der bestimmte Probleme anders gelöst werden als heute.
Im Lektorat merke ich schnell, ob eine Utopie trägt. Entscheidend ist nicht, wie gut alles ist, sondern wie glaubwürdig der Alltag wirkt. Eine Zukunft ohne Konflikte ist nicht interessant. Erst kleine Spannungen, unterschiedliche Vorstellungen oder strukturelle Grenzen machen die Welt lebendig. Utopien haben dann Tiefe, wenn sie Hoffnung zeigen, ohne sie zu vereinfachen.
Was dieses Subgenre besonders macht, ist der Blick auf Möglichkeiten. Es richtet die Aufmerksamkeit darauf, was entstehen könnte, wenn Kooperation, Neugier oder Verantwortung eine größere Rolle spielen. Die Welt muss nicht ideal sein, nur plausibel und ernst gemeint.
Woran du erkennst, dass du im utopischen Bereich schreibst:
Der Fokus liegt auf Lösungen statt auf Zerfall. Konflikte entstehen nicht durch Unterdrückung, sondern durch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine funktionierende Gesellschaft aussehen kann.
Space Opera
Space Operas bewegen sich oft in großen Strukturen: politische Systeme, ferne Orte, weitläufige Schauplätze. Im Lektorat zeigt sich jedoch schnell, dass diese Größe nur der Rahmen ist. Der Kern liegt fast immer in den Beziehungen zwischen den Figuren.
Viele Manuskripte versuchen, das große Ganze nachvollziehbar zu machen. Doch entscheidend bleibt, ob die Figuren darin handlungsfähig bleiben. Eine Space-Opera überzeugt, wenn die Welt weit sein darf, ohne die Menschen darin zu überlagern. Sobald Figuren nur noch Stellvertreter politischer Ereignisse werden, verliert das Genre an Wirkung.
Gute Space Operas nutzen ihre Größe, um zwischenmenschliche Konflikte klarer zu machen. Loyalität, Verantwortung, Macht und Verlust bekommen mehr Gewicht, wenn der Raum sich ausdehnt, aber die Handlung klar bei den Figuren bleibt.
Woran du erkennst, dass du im Bereich der Space Opera schreibst:
Die Welt ist groß, politische oder gesellschaftliche Kräfte spielen eine Rolle, doch der eigentliche Konflikt entsteht zwischen den Figuren, nicht zwischen Systemen.
Cyberpunk
Cyberpunk beschäftigt sich mit technologisch geprägten Gesellschaften, in denen soziale Unterschiede sichtbar sind. Im Lektorat sehe ich, dass dieses Subgenre selten nur von Technik handelt. Es zeigt Menschen, die in Umgebungen leben, die schneller, anonymer oder unübersichtlicher geworden sind.
Viele Texte folgen Figuren, die sich zwischen Anpassung und Widerstand bewegen. Zwischen digitaler Identität und realen Bedürfnissen. Der Konflikt entsteht nicht durch die Technologie selbst, sondern durch ihre Auswirkungen auf den Alltag.
Besonders typisch ist der Blickwinkel. Cyberpunk beobachtet oft von unten: aus der Perspektive derjenigen, die wenig Einfluss haben oder am Rand stehen. Genau dadurch entsteht die typische Spannung dieses Genres.
Woran du erkennst, dass du im Cyberpunk schreibst:
Technologie ist Teil der Handlung, aber der Schwerpunkt liegt auf Menschen, die mit ihren Folgen leben müssen. Konflikte entstehen durch soziale Ungleichheit, Überwachung oder Kontrollverlust.
Hard Science-Fiction
Hard Science-Fiction legt Wert auf wissenschaftliche und technische Plausibilität. Dabei wirkt sie im Lektorat oft weniger nüchtern, als man denkt. Die Technik ist selten Selbstzweck; sie bildet den Rahmen für Fragen, die die Figuren bewegen.
Viele Manuskripte entwickeln Prozesse und Prinzipien sorgfältig. Raumfahrt, Materialien, Energie, Medizin. Diese Genauigkeit schafft Glaubwürdigkeit, kann aber auch belasten, wenn Erklärungen die Handlung verlangsamen.
Eine überzeugende Hard-Science-Fiction-Geschichte hält die Balance. Die Logik der Welt ist verlässlich, aber sie dominiert sie nicht. Die Technik bleibt Hintergrund für Entscheidungen und Konflikte der Figuren.
Woran du erkennst, dass du im Bereich der Hard-Science-Fiction schreibst:
Technik oder Wissenschaft sind wesentlich für die Handlung. Die Welt muss logisch funktionieren, aber die Figuren bleiben der Mittelpunkt.
Near Future
Near-Future-Geschichten bewegen sich nur wenig von unserer Gegenwart weg. Sie greifen Entwicklungen auf, die heute bereits sichtbar sind. Im Lektorat zeigt sich, wie nah diese Texte an realen Strukturen bleiben. Ein kleines Detail kann genügen, um eine neue Dynamik entstehen zu lassen.
Die Stärke dieses Subgenres liegt in seiner Nähe. Leser*innen erkennen vieles wieder, und genau das macht die Zukunft glaubwürdig. Die Spannung entsteht aus der Frage, wie sich kleine Veränderungen auswirken könnten.
Gute Near-Future-Romane wirken plausibel, ohne sich im Realismus zu verlieren. Sie zeigen Entwicklungen konsequent weitergedacht und konzentrieren sich darauf, wie Menschen damit umgehen.
Woran du erkennst, dass du im Bereich der Near Future schreibst:
Die Welt deiner Geschichte entsteht sichtbar aus der Gegenwart. Veränderungen sind spürbar, aber nicht radikal. Der Fokus liegt auf ihren Folgen für den Alltag.
Postapokalypse
Postapokalyptische Geschichten setzen nach einem großen Einschnitt an. Die Katastrophe selbst bleibt meist Hintergrund; erzählt wird der Alltag danach.
Viele Manuskripte konzentrieren sich auf kleine Gruppen oder Einzelpersonen, die versuchen, unter neuen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben. Versorgung, Orientierung und Vertrauen spielen eine große Rolle. Konflikte entstehen durch knappe Ressourcen und moralische Entscheidungen.
Eine überzeugende Postapokalypse braucht keine Übertreibung. Sie wirkt, wenn die Veränderungen konsequent durchgehalten werden und Figuren eigene Ziele verfolgen, statt nur zu reagieren.
Woran du erkennst, dass du im postapokalyptischen Bereich schreibst:
Die Handlung beginnt nach einem einschneidenden Ereignis. Der Konflikt ergibt sich aus den neuen Lebensbedingungen und der Frage, wie Menschen darin handeln und Beziehungen gestalten.
Wie du dein eigenes Projekt einordnen kannst
Nach den einzelnen Subgenres stellt sich oft die Frage, wie das eigene Manuskript darin einzuordnen ist. Viele Autor*innen spüren zwar eine Tendenz, haben aber Schwierigkeiten, sie klar zu benennen. Das ist normal. Die meisten Geschichten verbinden mehr als eine Richtung.
Im Lektorat achte ich deshalb weniger auf Labels und eher auf das Grundgefühl eines Textes. Welche Art von Konflikt steht im Mittelpunkt? Wie wird die Welt erlebt? Welche Fragen tauchen immer wieder auf? Wenn du diese Punkte beantworten kannst, entsteht fast automatisch ein Bild davon, wo du deine Geschichte am besten einordnen kannst.
Subgenres sollen Orientierung geben, keine festen Grenzen. Sie helfen dabei, Entscheidungen zu treffen und ein Gefühl für den eigenen Schwerpunkt zu bekommen.
Ein Ansatz, der oft hilft:
Halte in ein paar Sätzen fest, welche Wirkung deine Geschichte haben soll: Spannung, Unruhe, Neugier, Hoffnung. Diese Eindrücke sind oft verlässliche Hinweise.
Fazit
Science-Fiction bietet viele Möglichkeiten, aber jedes Subgenre setzt einen bestimmten Schwerpunkt. Wenn du weißt, wohin deine Geschichte tendiert, wird vieles im Schreibprozess klarer. Du erkennst, welche Entscheidungen sinnvoll sind und wo noch Unsicherheit besteht.
Wichtig ist, dass Subgenres Orientierung bieten und keine Einschränkung. Manche Geschichten passen gut in eine Kategorie, andere sind eher Genre-Mixe und verbinden mehrere miteinander. Beides ist möglich.
Am Ende zählt, welche Art von Zukunft du erzählen möchtest und welche Fragen deine Figuren darin bewegen. Wenn das klar wird, findest du das richtige Genre für deine Geschichte.
Schreibe einen Kommentar