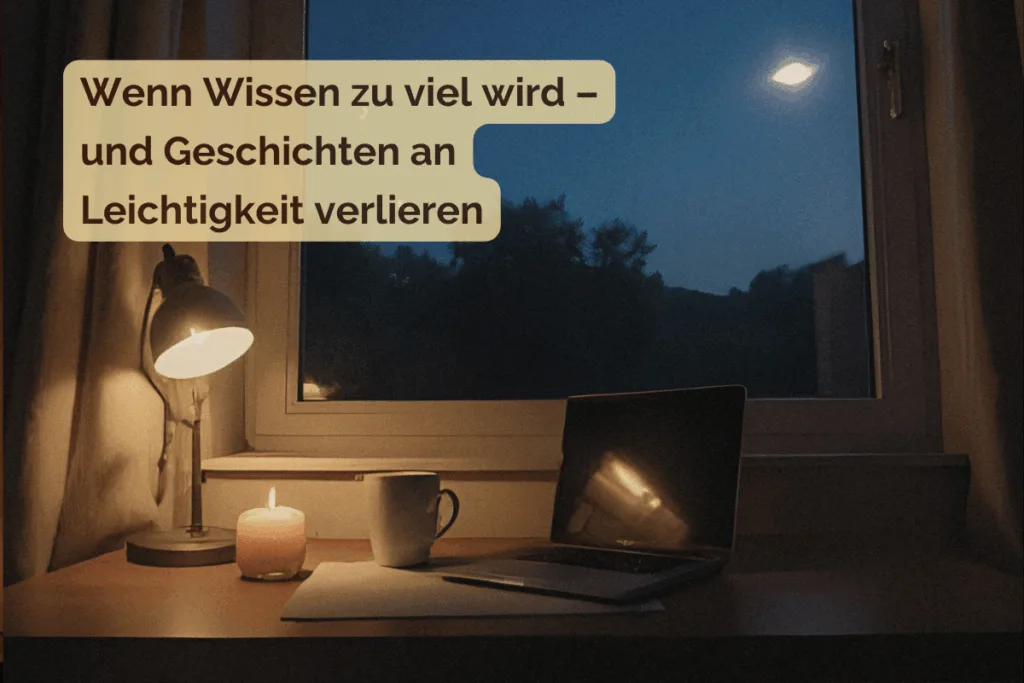
Fachbegriffe, Dialoge, Infodump – und wie du sie vermeidest
Science-Fiction ist das Genre der Möglichkeiten. Von fremden Welten bis zu künstlichen Intelligenzen: Alles darf gedacht, alles kann erzählt werden. Doch genau darin liegt die Schwierigkeit.
Viele Geschichten wollen so viele Details vermitteln, dass die Leser*innen kaum noch mitkommen. Oft ist das kein Mangel an Können, sondern an Vertrauen – in die Geschichte, in die Leser, in das eigene Gespür.
Beim Lesen solcher Texte merke ich, wie viel Herzblut darin steckt und wie sehr die Angst mitschwingt, etwas könne unverständlich bleiben. Doch Science-Fiction lebt nicht von Komplexität allein, sondern von Nähe. Diese Angst ist verständlich, aber sie kann Texte zu voll machen. Wenn du schreibst, darfst du deinen Leser*innen zutrauen, dass sie deine Geschichte verstehen, auch wenn sie nicht sofort alles begreifen.
In diesem Beitrag geht es um fünf typische Stolperfallen, die dieses Gleichgewicht gefährden, und darum, wie du sie erkennst, bevor sie dich ausbremsen.
1. Fachbegriffe und Leserorientierung
Kaum ein Genre liebt Fachbegriffe so sehr wie die Science-Fiction. Sie sind präzise, sie schaffen Atmosphäre, sie machen Welten glaubwürdig. Aber sie können auch Mauern bauen.
Wenn zu viele davon auftauchen, liest sich dein Text schnell wie ein Handbuch. Die Geschichte verliert an Leichtigkeit und die Lesenden fühlen sich ausgeschlossen.
Fachbegriffe sollen nicht beeindrucken, sondern einladen.
Oft schlage ich vor, einen Begriff bewusst nicht zu erklären. Manchmal genügt eine Reaktion der Figur. Ein Zögern, ein Blick, ein kurzer Kommentar. So verstehen die Leser*innen, worum es geht, ohne dass er erläutert werden muss.
Ein guter Begriff entfaltet seine Wirkung, wenn er sich selbstverständlich anfühlt.
Lass ihn Teil des Lebens deiner Figuren sein, nicht der Kulisse dahinter.
Tipp:
Sprich deine Sätze laut. Wenn du beim Lesen stolperst, stolpern deine Leser*innen wahrscheinlich auch. Manchmal genügt schon ein Wort weniger.
2. Dialoge in der Science-Fiction
Dialoge sind das Herz jeder Geschichte. Sie bringen Bewegung, zeigen Beziehungen, machen Gedanken sichtbar. In der Science-Fiction haben sie oft eine doppelte Funktion.
Sie müssen nicht nur Emotion transportieren, sondern auch Information.
Wenn Figuren über Technik, Forschung oder fremde Welten sprechen, geraten viele Texte ins Erklären. Sätze werden länger, die Sprache wird schwerer. Lesende spüren sofort, wenn ein Dialog nicht aus der Figur heraus entsteht, sondern geschrieben wurde, um Wissen zu vermitteln.
Ein guter Dialog funktioniert, wenn Informationen nicht erklärt, sondern zwischen den Zeilen spürbar werden. Auch in Zukunftswelten reden Menschen selten in vollständigen Theorien. Sie reagieren, zweifeln, denken halblaut. Sie erzählen, was sie bewegt, nicht, was sie wissen. Egal, ob sie mit einem Alien, einem Androiden oder einer KI sprechen, das Prinzip bleibt dasselbe. Entscheidend ist nicht, was gesagt wird, sondern wie.
Was berührt, ist nicht das Wissen, sondern die Begegnung.
Beim Lektorat achte ich darauf, ob Dialoge echt klingen, als hätten die Figuren sie selbst gesprochen. Ein Test hilft: Lies die Szene laut. Wenn du den Satz kaum aussprechen kannst, würde ihn deine Figur nicht sagen.
Tipp:
Lass eine deiner Figuren in einem technischen Gespräch einen Umweg machen.
Einen Witz, eine Beobachtung, ein persönliches Beispiel. So werden selbst komplexe Informationen greifbar und deine Welt wird lebendig.
3. Infodump und Wissensbalance
Wissen ist die Währung der Science-Fiction. Neue Welten, fremde Systeme, technische Erfindungen. Alles will verstanden werden. Doch genau hier lauert die größte Versuchung: zu viel zu erklären.
Viel Infodump entsteht aus einem guten Impuls heraus. Du willst, dass sich niemand verliert, dass deine Welt Sinn ergibt. Also erklärst du, fügst ein, beschreibst. Und dann merkst du nicht, wie die Geschichte langsam stillsteht, während du sie stabilisieren willst.
Information wirkt nicht durch Menge, sondern durch Vertrauen. Leser*innen folgen dir lieber, wenn sie fühlen dürfen, dass du die Welt kennst, und nicht, weil du sie erklärst. Neugier ist der stärkste Antrieb, um weiterzulesen. Was sofort verständlich wird, verliert schnell an Interesse.
Beim Lektorat achte ich darauf, wie das Wissen in der Geschichte vermittelt wird.
Treibt es die Handlung voran oder hält es sie auf? Bleibt Raum zum Entdecken oder ist schon alles gesagt? Gute Science-Fiction zeigt Zusammenhänge, ohne sie auszuleuchten. Sie legt Spuren, statt Wege zu beschreiben.
Manchmal reicht ein Nebensatz, ein Gerücht, ein Blick auf eine Anzeige am Straßenrand. Kleine Signale genügen, um eine Welt lebendig zu machen.
Was ungesagt bleibt, wirkt oft am längsten nach.
Tipp:
Suche in deinem Manuskript die Stellen, an denen du erklärst, wie etwas funktioniert.
Frage dich, ob dieselbe Information auch sichtbar werden kann: durch Handlung, Reaktion oder Atmosphäre. Oft entsteht aus einem erklärenden Absatz eine Szene, die mehr erzählt, als es jede Beschreibung könnte.
4. Perspektive und emotionale Glaubwürdigkeit
Science-Fiction öffnet Horizonte, aber sie bleibt nur greifbar, wenn ihre Figuren Emotionen hervorrufen.
Leser*innen folgen keiner Idee, sie folgen den Menschen oder den Wesen, mit denen sie sich identifizieren können. Selbst die faszinierendste Technologie verliert ihren Reiz, wenn niemand da ist, der sie erlebt.
Gerade in großen Zukunftsszenarien geraten Figuren leicht in den Hintergrund. Sie werden zu Trägern von Konzepten, zu Stimmen für eine Theorie. Dann spürt man den Verstand der Geschichte, aber nicht ihr Herz.
Glaubwürdige Figuren sind das Gegengewicht zu all dem, was in der Science-Fiction denkbar ist. Sie verankern die Handlung im Menschlichen, in Neugier, Angst, Trotz oder Staunen. Je größer die Welt, desto wichtiger wird die innere Perspektive. Wenn du merkst, dass sich eine Szene distanziert anfühlt, benutze sensorische Eindrücke: Was riecht, hört, spürt die Figur? Was weiß sie nicht? Was versucht sie zu begreifen?
Beim Lektorat achte ich auf diese Verbindung zwischen Außen und Innen. Wird die Handlung von echter Wahrnehmung getragen oder von dem Wunsch, etwas zu erklären? Sobald Figuren wieder sehen, statt zu sprechen, kehrt Lebendigkeit in den Text zurück.
Tipp:
Wähle für komplexe Szenen eine Figur, die nicht alles versteht. Dadurch wird auf zwei Ebenen Spannung erzeugt: in der äußeren Handlung und im inneren Begreifen.
Die Leser*innen entdecken die Welt dann gemeinsam mit der Figur – und bleiben emotional verbunden.
5. Tempo, Struktur und Lesefluss
Science-Fiction liebt große Bögen. Zeit, Raum, Geschichte: Alles greift ineinander.
Doch genau darin liegt die Gefahr: den Rhythmus zu verlieren.
Eine Geschichte braucht Atem. Zwischen Erkenntnis und Aktion, zwischen Dialog und Stille entsteht Spannung. Wenn Szenen zu dicht aufeinanderfolgen, bleibt kein Raum, um das Gelesene zu fühlen. Selbst starke Ideen wirken dann gehetzt, als würden sie sich gegenseitig überholen.
Tempo im Schreiben zeigt sich nicht an der Zahl der Ereignisse, sondern daran, wie sie wirken dürfen. Manchmal ist ein Text zu eng getaktet: Jede Szene will etwas sagen, aber keine lässt den Lesenden Zeit, sie zu fühlen. Figuren hetzen von Wendepunkt zu Wendepunkt, ohne dass das Dazwischen Gewicht bekommt.
Gutes Tempo entsteht, wenn Bewegung und Bedeutung sich abwechseln.
Eine Figur darf handeln, aber sie braucht auch den Moment danach, den Atemzug, in dem sie versteht, was gerade geschehen ist. Genau dort entsteht Spannung, weil Lesende miterleben dürfen, statt nur mitzulesen.
Im Lektorat sehe ich oft, dass ein Text stärker wird, wenn Autor*innen den Mut haben, weniger zu wollen. Ein Moment der Ruhe nach einem großen Ereignis kann mehr erzählen als eine Seite voller Erklärungen. Solche Pausen sind kein Stillstand. Sie sind das Echo dessen, was zuvor geschehen ist: der Moment, in dem die Bedeutung verstanden wird.
Manchmal hilft es, sich die Handlung als Musik vorzustellen: mit Pausen, Wiederholungen und Nachklang. Gerade in komplexen Welten sind es die stillen Takte, die den Klang formen. Wenn du beim Lesen spürst, dass du selbst kurz innehältst, ist das ein gutes Zeichen. Dann hat der Text seinen Rhythmus gefunden.
Tipp:
Lies dein Manuskript laut oder lass es dir vorlesen. Wenn du an einer Stelle spürst, dass du innerlich abschaltest, ist sie wahrscheinlich zu voll. Versuche, dort zu kürzen oder das Tempo herauszunehmen. Der Lesefluss entsteht, wenn Text und Atem denselben Rhythmus finden.
Fazit
In Science-Fiction geht es um Wissen, aber was uns darin berührt, ist das Gefühl. Wir sehen, was möglich ist, und erinnern uns daran, was bleibt. Die Stärke von Science-Fiction liegt nicht in der Genauigkeit, sondern darin, dass es sich anfühlt, als könnte man dort leben.
Beim Schreiben geht es nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, die in Erinnerung bleibt. Wenn du vertraust, dass dein Text alles zeigt, entsteht Raum für das, was wirklich wirkt: Nähe, Staunen, Erinnerung.
Und manchmal reicht genau das, um aus einer Idee eine Welt zu machen.
Schreibe einen Kommentar