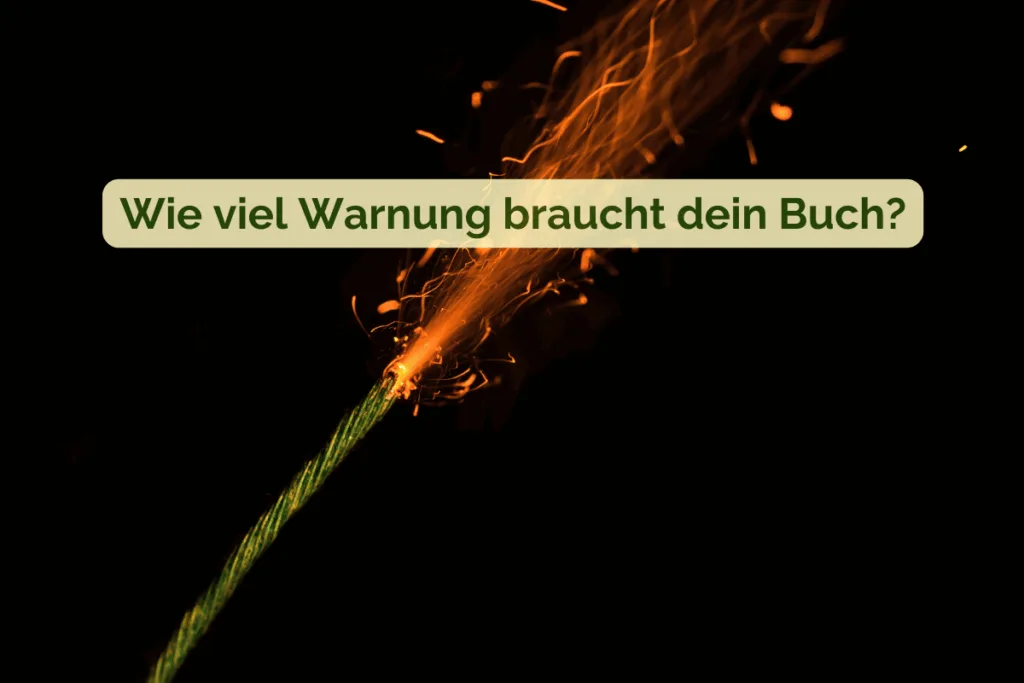
Warum Triggerwarnungen und Contentnotes wichtig sind
Stell dir vor, du hast eine intensive Szene geschrieben. Sie ist spannend, sie ist emotional, aber sie behandelt auch ein schwieriges Thema wie Gewalt oder Missbrauch. Du fragst dich: Soll ich meine Leser*innen darauf vorbereiten? Oder nimmt das der Geschichte die Wirkung?
Genau an diesem Punkt kommen Triggerwarnungen und Contentnotes ins Spiel. Sie sind kein starres Regelwerk, sondern ein Werkzeug. Richtig eingesetzt, können sie Orientierung geben und Vertrauen schaffen.
Triggerwarnungen und Contentnotes – was ist der Unterschied?
- Triggerwarnung: Sie weist auf Inhalte hin, die für Betroffene retraumatisierend wirken können, zum Beispiel Suizid, Missbrauch oder Kriegserfahrungen.
- Contentnote: Sie wird neutraler formuliert und informiert allgemein über sensible Themen, etwa psychische Erkrankungen, Essstörungen oder Drogenmissbrauch.
Beispiele:
- Triggerwarnung: „Dieses Buch enthält Darstellungen von Suizid.“
- Contentnote: „Dieses Buch thematisiert psychische Erkrankungen.“
Beide Varianten haben ihre Berechtigung. Entscheidend ist, welche Haltung du als Autor*in hast und wie du deine Leserschaft abholen möchtest.
Wann sind Triggerwarnungen und Contentnotes sinnvoll?
Es gibt kein allgemeingültiges Richtig oder Falsch. Aber folgende Fragen helfen dir bei der Entscheidung:
- Enthält mein Text Szenen, die stark belasten oder retraumatisieren könnten?
- Würde ich mir selbst in dieser Situation einen Hinweis wünschen?
- Was erwarten meine Leser*innen in diesem Genre?
In Romance und Jugendbüchern sind Contentnotes inzwischen fast selbstverständlich. In Thrillern oder Fantasy tauchen sie seltener auf, können aber genauso sinnvoll sein, zum Beispiel bei Darstellungen von Folter oder sexualisierter Gewalt.
Wo platzierst du Triggerwarnungen und Contentnotes?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, und keine davon ist „die einzig richtige“:
- am Anfang des Buchs, noch vor Prolog oder erstem Kapitel
- im Vorwort oder in den Danksagungen
- im Klappentext (oft am Ende, klar abgegrenzt)
- in der Online-Buchbeschreibung im Shop
Eine zusätzliche Option ist ein zweistufiger Hinweis:
Am Anfang steht der Satz „Dieses Buch enthält eine Contentnote auf Seite XY“. Die eigentliche Contentnote findet sich dann auf dieser Seite. Jede*r Leser*in kann so selbst entscheiden, ob er oder sie die Contentnote liest oder direkt in die Geschichte einsteigt.
Triggerwarnungen und Contentnotes formulieren
Eine gute Formulierung ist:
- kurz
- klar
- neutral
Vermeide Details oder wertende Formulierungen. Nenne das Thema, nicht die Szene.
Beispiele:
- „Dieses Buch enthält Darstellungen sexualisierter Gewalt.“
- „In dieser Geschichte geht es um Essstörungen.“
- „Das Buch behandelt psychische Erkrankungen.“
So informierst du, ohne zu spoilern oder unnötig zu belasten.
Brauche ich als Lektorin Triggerwarnungen?
Im Lektorat selbst brauche ich keine Triggerwarnung. Bevor es losgeht, spreche ich immer ausführlich mit dem jeweiligen Autor*in über das Manuskript, und dabei kommen auch sensible Inhalte zur Sprache. So kann ich den Text gut einordnen und weiß, worauf ich achten muss.
Für die Leser*innen kann eine Contentnote oder Triggerwarnung jedoch sinnvoll sein. Gemeinsam mit Autor*innen kläre ich zum Beispiel:
- Ob eine Warnung im konkreten Fall sinnvoll ist
- Wie sie klar und respektvoll formuliert werden kann
- Wo sie am besten platziert wird
So bleibt die Geschichte authentisch und deine Leser*innen fühlen sich ernst genommen.
Fazit: Deine Haltung entscheidet
Triggerwarnungen und Contentnotes sind keine Pflicht, aber sie sind eine Möglichkeit. Sie sollen nicht jedes mögliche Risiko abdecken, sondern zeigen, dass du dir Gedanken gemacht hast. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und deine Leser*innen ernst zu nehmen.
Wenn du dich bewusst für oder gegen eine Warnung entscheidest, machst du deine Haltung sichtbar. Genau das schafft Vertrauen und zeigt, dass du deine Leser*innen respektierst.
Hast du in deinen Büchern schon einmal Triggerwarnungen oder Contentnotes eingesetzt?
Schreibe einen Kommentar